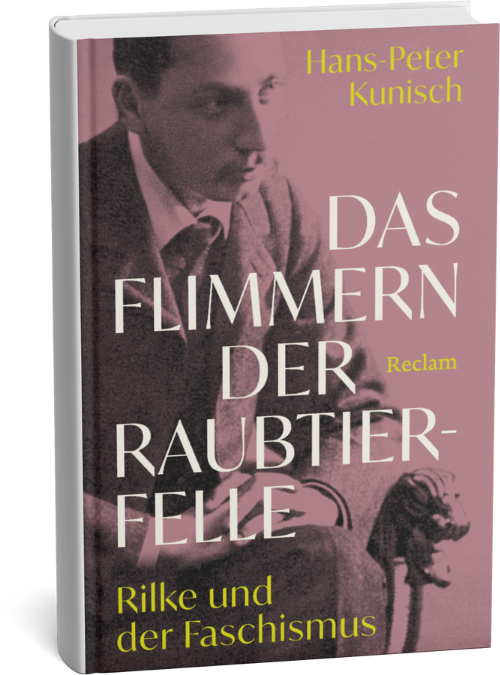Seit der ersten Entdeckung der politischen Briefe, die Rilke mit der Herzogin Aurelia („Lella“)
Gallarati-Scotti zwischen 1921 und 1926 wechselte, wird von vielen, allzu ergebenen Rilke-Anhängern
versucht, sie nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Darum gibt es, über siebzig Jahre nach der Entdeckung, noch heute keine ordentliche deutschsprachige
Ausgabe dieser Briefe und Rilkes Beweggründe für seine überraschende Stellungnahme für den italienischen
Faschismus und Mussolini blieben über Jahrzehnte weitgehend unerforscht. Ein erster Ansatz dazu vor mehr
als fünfzig Jahren wurde schnell unterdrückt und ein vorurteilsfreier Umgang mit den Positionen Rilkes
damit verhindert.
Noch eindeutiger ist die bisherige Missachtung der Rolle von Lella Gallarati-Scotti, die durch ihren
mehrmaligen entschiedenen Widerspruch die nach dem Sturz der Münchner Räterepublik radikal rechte
Geschichtsphilosophie Rilkes erst sichtbar macht und einen Blick dafür erzeugt, wo diese auch in seinen
literarischen Werken - von ersten Veröffentlichungen bis hin zu den Duineser Elegien und den
Sonetten an
Orpheus - spürbar ist.
Lellas klare antifaschistische Position, ihre Gründe dafür und damit ihre dynamische Rolle im Briefwechsel
werden hier zum ersten Mal wirklich untersucht. Trotz Ansätzen, Lellas Position zu begreifen, verweigert
sich Rilke immer wieder. Zu einem möglicherweise klärenden persönlichen Gespräch, zu dem Lella Rilke gegen
Ende des Briefwechsels noch einmal einlädt, kommt es nicht mehr.
Das Flimmern der Raubtierfelle bietet einen überraschenden neuen Blick auf Rilke, der hier ohne
Scheuklappen analysiert wird. Das „Raubtier“, als klassisches Leitbild autoritärer Führer, ist eine der
schillerndsten und aufschlussreichsten Chiffren, die Rilke wie Mussolini mit Friedrich Nietzsche, einem
ihrer wichtigsten gemeinsamen Ahnherren verbindet.
In Das Flimmern der Raubtierfelle werden keine Gründe gesucht, warum Rilke „nicht mehr gelesen
werden darf“
oder Ähnliches. Im Gegenteil: er sollte mehr und genauer gelesen werden, nicht blind und verniedlichend,
nicht
als zierlicher Gartenzwerg oder Schoßhund und beruhigendes Antidot gegen eine struppige Gegenwart.
Sondern als einer der größten Dichter deutscher Sprache, der in seinen besten Werken existentiell
wagemutig
schrieb, wie selten einer, aber in ähnlich unsicher-bewegten Zeiten lebte wie heute und dabei politisch
auf
Abwege geriet. Lella Gallarati-Scotti führt uns vor, dass wir ihm dabei nicht folgen müssen, aber ihn als
Künstler und Mensch trotzdem schätzen können. Und sie lässt uns überlegen, was im Umgang mit ähnlichen
Positionen heute zu tun ist.